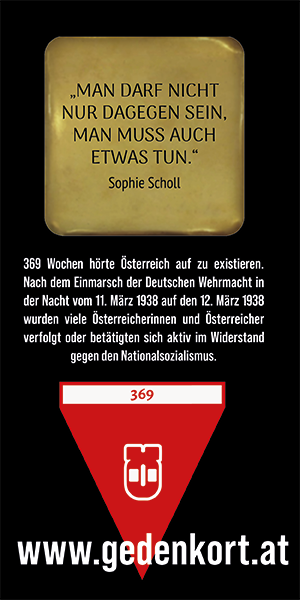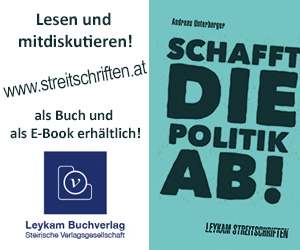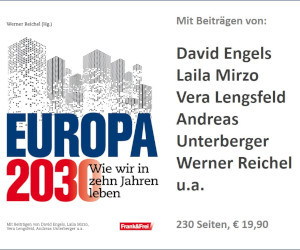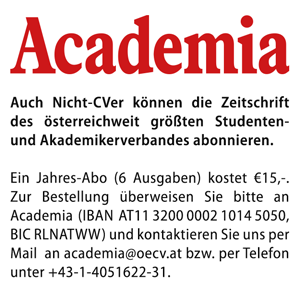„Frau Merkel ist in Deutschland gewählt, ich in Frankreich. Aber heute treffen wir Entscheidungen für Länder, in denen wir nicht gewählt wurden“ so der damalige Präsident Nicolas Sarkozy in einer Pressekonferenz zum Euro-Rettungsschirm, am Sonntag 23. Oktober 2011 in der ZIB2.
Manche Entscheidungen, Frau Merkel, hätten wir lieber selbst getroffen – nicht nur in Bezug auf die Euro-Krise, sondern etwa auch in der Migrationsfrage.
Kein Wunder also, dass sich mittlerweile nicht nur Kritiker, sondern bereits auch hochrangige Vertreter des EU-Establishments fragen, ob es die EU zerreißen könnte.
Seit einigen Jahren zeigt sich, dass die Schönwetterunion zwar enorm „effizient“ beim Verteilen der Gelder der Nettozahler ist, aber unfähig und planlos agiert, wenn es gilt, Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Etwa seit Jahren in der Eurozone, wo die Geldpolitik der EZB nicht nur die Enteignung der Bürger vorantreibt, sondern auch die notorischen Schuldenmacher alles andere als ermuntert, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. In erster Linie gilt das für Frankreich, das seit Jahren säumig ist – ohne allerdings einen Brief aus Brüssel zu erhalten (das kann man doch der Grande Nation nicht antun!). Kein Wunder also, dass die Budgetsünder ein enormes Interesse an einer Fiskalunion und auch an einer gemeinsamen EU-Einlagensicherung haben; von der gescheiterten Griechenland-Rettung ganz zu schweigen, die durch konsequenten Bruch von EU-Recht , das keine Umverteilung unter den Mitgliedern vorsieht, durchgezogen wird.
Und dann noch die aktuelle Migrationskrise, befeuert durch eine verantwortungslose „Einladung“ der deutschen Kanzlerin. Seitdem ist es allen schmerzlich bewusst, dass die Sicherung der Außengrenzen seit Jahren für die Schönwetter-Politiker kein Thema ist.
Die Reaktion auf diese jahrelangen Versäumnisse ist Panik: man verhandelt plötzlich wieder mit der Türkei, die vor kurzem noch als Unrechtstaat bezeichnet wurde und die immer stärker in einen vordemokratischen Zustand abdriftet. Eine charakterlose, kurzsichtige und feige Politik entsorgt damit die „Werte“, die in Festansprachen so gern strapaziert werden.
Anstatt sich ernsthaft um die anstehenden Probleme zu kümmern, droht die Kommission – quasi zur Ablenkung – der neuen polnischen Regierung mit einem Verfahren. Wie anlässlich der unseligen „Sanktionen“ gegen Österreich vor 16 Jahren hat die EU auch diesmal weder eine juristische, noch eine moralische Grundlage für ihre Kraftmeierei. Damit ist die nächste Blamage vorprogrammiert. Den Schaden hat dann nicht die Kommission, sondern die Union als Ganzes.
Verantwortungsvolle Politiker, wie etwa der britische Premier David Cameron oder der niederländische Regierungschef Mark Rutte wollen bei diesen vielen Irrwegen nicht mehr mittun. Für sie – wie auch für juristische Experten – ist das Streben nach einer „immer engeren Union“ eine gefährliche Drohung, denn dadurch werden die demokratisch legitimierten nationalen Parlamente schleichend entmachtet.
Großbritannien, die Niederlande oder auch skandinavische Länder wollen die positiven Errungenschaften der EU – vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Integration und des Binnenmarktes – nicht durch falsche Entscheidungen in andern Bereichen gefährden. Ja der Binnenmarkt soll weiter vertieft werden, denn noch immer gibt es starke und vielfältige protektionistische Widerstände. Die allesamt konstruktiven und diskussionswürdigen Vorschläge Camerons sind ein vernünftiger Ansatz statt zentraler Überregulierungen wieder stärker auf die nationalen Souveränitäten und Verschiedenheiten zu setzen. Auch der niederländische Premier Rutte hat sich in diesem Sinne geäußert.
Das Vereinigte Königreich ist – trotz des sogenannten „Britenrabattes“ – nach wie vor Nettozahler und es ist eine billige Polemik, die britischen Reformwünsche als „Extrawürste“ zu bezeichnen, wie das etwa unser Bundeskanzler wenig faktenbasiert tut. Es ist zu hoffen, dass sich bei den Verhandlungen im Februar die Briten nicht nur durchsetzen, sondern dass dadurch auch ihr Verbleib in der EU gesichert wird. Denn die marktliberale britische Position ist eine wichtige Stimme der Vernunft gegen südliche Schuldenpolitik, französische „planification“ oder luxemburgische Schlitzohrigkeit (wenn man an die unsauberen Steuertricks denkt, die in der Zeit von Jean Claude Juncker zustande kamen).
Die Verhandlungen sind eine Chance, Europa wieder näher zum Bürger zu bringen und eine zentralisierungswütige Nomenklatur aus Politik und Bürokratie einzubremsen. Groß ist die Hoffnung nicht, denn die Profiteure des falschen Weges repräsentieren eine mächtige Lobby, die einiges zu verlieren hat.
Prof. Dr. Herbert Kaspar war langjähriger Herausgeber und Chefredakteur der ACADEMIA. Der Beitrag ist sein geringfügig adaptierter Gastkommentar in der Februar-Ausgabe der ACADEMIA