Im Kreis der europäischen Regierungschefs gibt es zwei Ministerpräsidentinnen, die im Unterschied zu ihren hyperventilierenden männlichen Kollegen gelassen, entschieden und selbstbewusst auf Donald Trump reagieren: die dänische Sozialdemokratin Mette Frederiksen und die italienische Nationalkonservative Giorgia Meloni. Beiden wissen, was auf dem Spiel steht.
Friederiksen steht unter dem massiven Druck der Trump-Administration, Grönland den Amerikanern zu übergeben. Ihre Botschaft an die USA vom 3. April ist es wert, ausführlich zitiert zu werden:
"Seit dem Zweiten Weltkrieg habt ihr die freie Welt verteidigt, ihr habt Wohlstand und Fortschritt geschaffen, Frieden und Freiheit. Und wir haben versucht, euch etwas zurückzugeben, indem wir euch immer unterstützt haben und immer da waren, wenn ihr uns gerufen habt. (…) Ich wünsche nichts sehnlicher, als dass unsere Freundschaft weiterbesteht. Denn wenn wir uns als Verbündete entzweien lassen, machen wir unseren Feinden einen Gefallen. Ich werde alles tun, um das zu verhindern. Deshalb: Wenn ihr unsere Unternehmen bittet, in den USA zu investieren, dann tun sie es. Wenn ihr uns auffordert, mehr für unsere Verteidigung auszugeben, dann tun wir es. Und wenn ihr uns bittet, die Sicherheit in der Arktis zu stärken, sind wir auf eurer Seite. Aber wenn ihr einen Teil des Territoriums des Königreichs Dänemark übernehmen wollt, wenn wir von unserem engsten Verbündeten bedroht und unter Druck gesetzt werden, was sollen wir dann von dem Land halten, das wir seit so vielen Jahren bewundern? (…) Ihr wisst, wofür wir stehen und dass wir nicht nachgeben. Und deshalb muss ich ganz klar sagen: Nationale Grenzen, Souveränität der Staaten, territoriale Integrität, diese Prinzipien sind im Völkerrecht verankert. (…) Deshalb geht es nicht nur um Grönland oder Dänemark, es geht um die Weltordnung, die wir quer über den Atlantik in Generationen aufgebaut haben. Ihr könnt nicht ein anderes Land annektieren. Nicht einmal mit dem Argument der internationalen Sicherheit."
Die Zersplitterung und Schwächung des globalen Westens – ohne die Putin es nicht gewagt hätte, 2008 in Georgien und seit 2014 wiederholt in der Ukraine einzufallen – hat nicht mit Trump begonnen, er hat sie jedoch gewaltig beschleunigt. Was Amerika betrifft, geht es nicht nur um die Drohungen gegen Grönland, Kanada und Panama, nicht nur um die Weigerung, die Ukraine zur unterstützen oder die unberechenbare merkantilistische Wirtschaftspolitik, die weltweit die Märkte erschüttert. Es geht um das alles und um viel mehr, nämlich um den Fortbestand der westlichen Welt, die zugleich von außen und von innen angegriffen wird.
Das Schlimmste daran ist, dass die damit verbundenen Gefahren entweder nicht gesehen oder absichtlich relativiert werden. Nato-Generalsekretär Mark Rutte behauptet zum Beispiel wider alle Evidenz, das transatlantische Bündnis sei stark wie nie und werde nur noch stärker werden.
Appelle, doch endlich ein von den USA sicherheitspolitisch unabhängiges Europa zu schaffen, gehen ins Leere. Tatsächlich befindet sich Europa gegenüber Amerika in einer vergleichbaren Lage wie Österreich gegenüber der EU: Zurecht stellte Wolfgang Schüssel seinerzeit fest, dass Österreich gar nichts anderes übrigbleibe, als sich "mit Zähnen und Klauen" an der EU festzuklammern. Ähnlich gilt für Europa: Nur im Bündnis mit den USA hat es eine Chance, Sicherheit und Wohlstand zu bewahren. Die europäische Vielfalt, die sich in der Geschichte auf so vielen anderen Gebieten bewährt hat, ist keine gute Voraussetzung für eine gemeinsame Verteidigung, allein schon wegen der komplizierten und langwierigen Entscheidungsprozesse.
In einem Interview mit der "Financial Times" (ihrem ersten für eine ausländische Zeitung, seit sie 2022 ihr Amt antrat) warnte Giorgia Meloni eindringlich davor, den transatlantischen Graben zu vertiefen. Die Idee, Italien habe sich zwischen der EU und den USA zu entscheiden, sei "kindisch" und "oberflächlich". Der Präsident der Vereinigten Staaten sei kein Gegner, sondern der "erste Verbündete" Italiens. Als Konservative stehe sie Trump näher als viele andere, aber wenn er seine nationalen Interessen vertritt, "dann ich die meinen". Seit langem verfolgten die Vereinigten Staaten eine protektionistische Agenda, oder "glauben sie wirklich, dass der Protektionismus in den USA von Donald Trump erfunden wurde?" Aber das ändere nichts daran, dass "die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten die wichtigsten sind, die wir haben." Wenn es etwas gibt, was Italien tun kann, um einen Konflikt zwischen Europa und den USA abzuwenden und Brücken zu bauen, werde sie es tun, denn das liege im Interesse der Europäer.
Auch in ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine setzt Meloni eigene Akzente. Sie hat sich im Gegensatz zu führenden Politikern der AfD und der FPÖ, aber auch zu ihrem populistischen Koalitionspartner Matteo Salvini (Lega) von Anfang an klar für die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen – dies, obwohl Antiamerikanismus und billiger Pazifismus in Italien unter Linken und Rechten sogar noch stärker verankert sind als in Deutschland und in Österreich.
Allerdings hält Meloni nichts von der Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. An der von Emmanuel Macron und Keir Starmer initiierten Konferenz einer "Koalition der Willigen" im Nato-Hauptquartier am 10. April nahm Italien nur als Beobachter teil. Meloni befürchtet, dass die noch mitten im Krieg angezettelte Debatte über die Stationierung von Nato-Soldaten nur der russischen Propaganda in die Hände spielt. Stattdessen schlägt sie vor, den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags auf die Ukraine auszudehnen. Es gäbe dann zwar keine Truppen und Einrichtungen der Nato auf ukrainischem Territorium, aber jeden Angriff auf das Land würde sie als Bündnisfall betrachten. Da der Nato-Rat seine Entscheidungen einstimmig trifft, hat der Vorschlag vorerst leider wenig Aussicht, angenommen zu werden.
Karl-Peter Schwarz ist Autor und Journalist; er war früher bei "Presse", ORF und FAZ tätig.

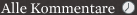
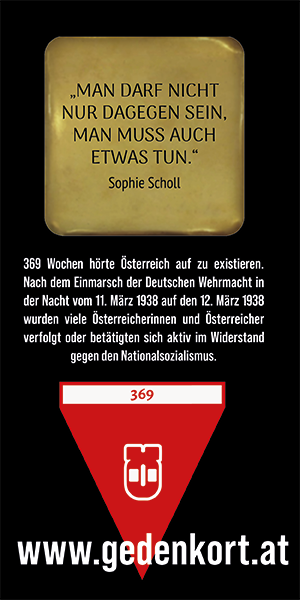



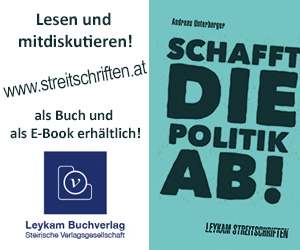
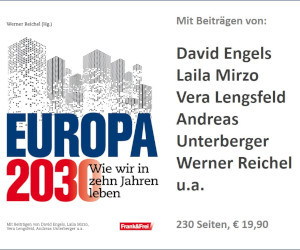

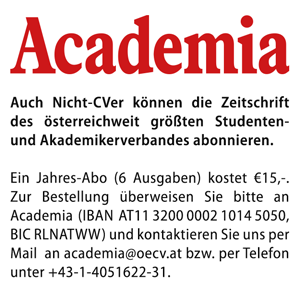

Die Rede von der Frederiksen ist gut, sehr gut, sie stimmt nur leider nicht ganz. Die USA müssen Dänemark nicht darum bitten, mehr für Militär und Sicherheit auszugeben; das ist bereits im NATO-Vertrag festgelegt, dass jeder Mitgliedsstaat mindestens 2% des BIP so zu investieren hat. Dänemark hat (laut „Statista“) 2023 einen Prozentsatz von 1,95 % geschafft. Das ist zwar immerhin knapp dran, aber eigentlich noch immer Vertragsbruch - und es war der höchste Wert, den sie in den letzten 15 Jahren erreicht haben!
Die Rede von Fredriksen ist bemerkenswert. Dann folgt aber schon der Kern des Artikels: die EU ist ohne die USA hilflos und muss sich mit Zähnen und Klauen an diesen festklammern. Dieses Festklammern ist auch die einzige Möglichkeit, die Entscheidungsschwäche eines Europa der Vaterländer zu kaschieren - einfach tun, was der große Bruder sagt.
Völlig klar, dass die Meloni nicht eine Sekunde daran denkt, die Verbindung mit den USA irgendwie schlecht zu reden. Man stelle sich vor, die ganzen Truppenstützpunkte würden kein Geld mehr in Italien lassen.
Wenn die UA den Art 5 des NATO Vertrages geltend machen könnte - wie soll das gehen, dass keine NATO-Truppen in der UA stehen? Wie würde denn die NATO einen Angriff von Russland auf ein Mitgliedsland beantworten?
Zur Unterstützung der UA ist der Artikel von Egon Flaig wirklich hilfreich, um ein differentiertes Bild zu bekommen. Muss Europa wirklich die Flucht der vielen wehrfähigen Männer kompensieren?
Das ist ein polit. Versagen der UA